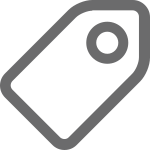Es kann sich lohnen, die Grundannahmen des Wissensmanagements zu hinterfragen

Zuletzt geändert am 9. 9. 2020 von Admin.
Inhaltsverzeichnis
Wissen als sozial eingebettet sehen – statt als Merkmal der Individuen[Bearbeiten]
Eine der wichtigsten Grundannahmen der Wissensmanagement-Ansätze, die in der Praxis Anwendung finden, ist die Verankerung des Wissens auf der Ebene des Individuums (d. h. Wissen immer als an Personen gebunden zu sehen und somit als ein subjektives Merkmal). Was bei dieser Perspektive oft aus dem Blick gerät, sind die intersubjektiven, d. h. sozialen Wissensstrukturen. Die unterschiedlichen praktischen Aufgaben, Interpretationsmuster und Werte, die einer Information Sinn und Zweck geben (und sie auf diese Weise zu Wissen aufwerten), sind sozial geteilt. Es ist daher durchaus sinnvoll, die Analyse der Wissensbestände in einer Organisation auf der Ebene der sozialen Wissensstrukturen (statt Individuen) anzusiedeln. Das Individuum ist in einer solchen Perspektive »nur« als das Ergebnis der (oft unreflektierten) Beteiligung an formellen und informellen, wie auch mehr oder weniger dauerhaften Kollektiven und daher Aussetzung von Sozialisations-/Akkulturationsprozessen, in denen Wissen weitergegeben wird, zu sehen. Die aus der Perspektive des Wissens wichtigen Prozesse und Merkmale finden nicht in den einzelnen Köpfen statt, sondern in intersubjektiven »Räumen«, durch gemeinsames Tun und Austausch.
Die Wissenssoziologie und Organisationswissenschaften kennen seit langem Ansätze und Begrifflichkeiten, die sich für das Erfassen dieser sozialen Ebene des Wissens gut eignen. Fleck hat schon in den frühen 1930ern mit dem Begriff der Denkkollektive die soziale Bildung von wissenschaftlichen Tatsachen beschrieben, der Begriff wurde aber auf unterschiedliche soziale Zusammenhänge angewendet. Wenn »zwei oder mehrere Menschen Gedanken austauschen«, werden Aussagen formuliert und ausgesprochen, die die einzelnen Individuen alleine oder in anderen Gruppen nicht formulieren würden (Fleck 1980, s. 135; Sady 2016). Durch diesen Austausch entsteht ein gemeinsamer Denkstil, der sich auch durch eine Beharrungstendenz auszeichnet, und somit eine Grundlage für ein Denkkollektiv darstellt.
Es wurden in den letzten Jahrzehnten weitere nützliche und in ähnliche Richtungen gehende Konzepte entwickelt. Das Konzept der »epistemischen Communities« (Haas 1989) beschreibt wie Gruppen, wo Mitglieder aus unterschiedlichen Bereichen (Politik, Verwaltung, Wissenschaft) zusammenkommen können, gemeinsamen Wortschatz und Erwartungen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und dadurch auch geteilte Werte entwickeln. Der in der Managementlehre populäre (und oft als ein Tool missverstandene) Begriff der »Communities of Practice« (Lave und Wenger 1991, Wenger 1998) beschreibt, wie Lernen als sozialer Prozess erfolgt. Die Basis für Wissensbewahrung und –weitergabe sind Communities, die sich über die Zeit aus Personen entwickeln, die an der gleichen Praxis teilnehmen, ein gemeinsames »Problem« (concern) teilen und die Möglichkeit zum Austausch besitzen. Man könnte zu einem Schluss kommen, eine »realistischere Sicht der Organisation mag so eine sein, die Organisationen als Minigesellschaften mit einem multikulturellen Charakter versteht, wo sich in jeder ausgeprägte, sich konkurrierende und potenziell entgegenstehende lokale Kulturen entlang den Funktionslinien, geteiltem Verhängnis, professioneller Tätigkeit, ethnischem Hintergrund oder Dienstrang gebildet haben« (Alavi, Kayworth und Leidner 2006, S. 196). Wichtig wäre anzuerkennen, dass sich solche Kulturen über formale organisationale Grenzen (innerhalb und außerhalb der Organisation) hinausstrecken können. Ansätze zu Wissensmanagement mit einem zugrundeliegenden mechanistischen und naturwissenschaftlichen Weltbild (»Information« als grundlegende Einheit, verwertende Transformation entlang einer Wissenstreppe) sehen Wissen und »lokale Kulturen« als großteils unabhängig. Jedoch gibt es – überspitzt gesagt – kein Wissen ohne ein (kollektives) Tun und kein Tun ohne eine (lokale) Kultur, in die das Tun eingebettet ist (vgl. Nicolini, Gherardi und Yanow 2003, Wagenaar 2004, Petts & Brooks 2006). Es gibt kein allgemein gültiges und unabhängig existierendes Wissen und das, was als Wissen aus der Perspektive einer Kultur erscheint, mag völlig unterschiedlich aus der Perspektive einer anderen Kultur interpretiert werden: »Gehören A und B demselben Denkkollektiv an, dann ist der Gedanke für beide entweder wahr oder falsch. Gehören sie aber verschiedenen Denkkollektiven an, so ist es eben nicht derselbe Gedanke, da er für einen von ihnen unklar sein muß oder von ihm anders verstanden wird.« (Fleck 1980, S. 131; s. auch das Konzept der »boundary objects« von Star & Griesemer 1989).
WissenschafterInnen streiten sich zwar seit Langem darüber, was genau eine »Kultur« ausmacht (vgl. Alavi, Kayworth und Leidner 2006); unter den KandidatInnen für zentrale Merkmale wurden unter anderem Werte, geteiltes Verständnis und Interpretationsmustern, Normen, Praktiken, Symbole, materielle Artefakte oder Sprache / Wortschatz diskutiert. Die Wissensprozesse und –probleme einer Organisation können aber, so das Argument, durch die Optik der einzelnen »lokalen Wissenskulturen« (ob als Denkkollektive, epistemische Communities, Communities of Practice oder diskursive / interpretative Communities gedacht) und ihren Interaktionen begriffen werden. Daher wäre es wichtig. die bestehenden sozialen (formellen und informellen) Wissensstrukturen und –flüsse in der Organisation und über ihre Grenzen hinaus zu verstehen, bevor normative Maßnahmen getroffen werden.
Wissen als mannigfaltig sehen – statt als kognitiv[Bearbeiten]
Wenn sich Wissen an dem Vollzug der Praxis beteiligt, nimmt es unterschiedliche Formen an. Wissen ist nicht nur eine kognitive Leistung und etwas, das sich nur in den Köpfen »befindet«. (Der verstärkte Fokus auf den kognitiven Charakter des Wissens geht oft einher mit einer umstrittenen konzeptuellen Trennung zwischen Wissen und Tun.) Wissen ist durchaus auch körperlich und materiell und viele Wissensformen, die wir als abstrakt oder geistig wahrnehmen, nehmen auch eine materielle Form an (Law 2009). Die Vielfalt der Wissensformen hat aber auch wichtige funktionale Auswirkungen: unterschiedliche Wissensformen lassen sich unterschiedlich leicht (oder schwierig) in konkrete Praxen und deren Kulturen integrieren.
Wissen ist z. B. in materielle Artefakte eingeschrieben und dies betrifft nicht nur formale Dokumentation. Wissen verbirgt sich auch in Arbeitsinstrumenten, wo sich ein bestimmtes Verständnis über den menschlichen Körper und den Zweck und Kontext der Tätigkeit, in der das Instrument verwendet wird, in Designentscheidungen wiederspiegelt. Wissen ist auch die räumliche Organisation und individuelle Anpassung solcher Instrumente am Arbeitsplatz (Post-Its am Bildschirm, Markierungen in oft verwendeten Manualen, Ausdruck einer wichtigen Tabelle an der Pinnwand), die die Durchführung einer Aufgabe durch das Delegieren eines Teils der kognitiven Leistung an Artefakte erleichtern (Stichwort »distributed cognition«). Diesen Wissensformen wird durch die Digitalisierung des Arbeitsplatzes und stets steigende Integration mobiler Geräte und Anwendungen in Lebenspraxen eine neue Relevanz gegeben.
In der empirischen Forschung wird die Rolle der räumlich-sozialen Organisation des Arbeitsplatzes als ein Wissensmerkmal bestätigt. Büroorganisation, Sitzordnung und Sichtbarkeit oder physische Verteilung der KollegInnen durch das Gebäude gestalten die soziale Struktur und Prozesse des Wissens und Lernens mit und beeinflussen z. B. wie sich informelle Spezialisierungen der einzelnen Teammitglieder auf Teilbereiche der Aufgabe entwickeln. Die soziale Einbettung und Situierung des Wissens ist, wie oben angedeutet, eine zentrale Charakteristik des Wissens, da das Erlernen oder Durchführen der meisten Aufgaben auf sozialer Interaktion (Kooperation, Austausch) beruhen – diese soziale Struktur hat aber auch eine räumliche Ausprägung. Einzelne Individuen können in so einem, um ein Bündel von Aufgaben sozial und räumlich entstandenen Kollektiv (Community of Practice etwa), unterschiedliche soziale Positionen »befüllen«. So kann sich aufgabenrelevante Fachexpertise an Plätzen entwickeln, die man anhand des Organigramms oder der Arbeitsplatzbeschreibung nicht erwarten würde.
Letztendlich »befindet sich« auch im menschlichen Körper Wissen nicht nur im Kopf. Wissen – besonders in Form von unterschiedlichen Fertigkeiten – ist stark mit motorischen und sensorischen Dispositionen des Körpers verknüpft (vgl. »embodied knowledge« von Freeman & Sturdy 2014; s. auch Reckwitz 2003), wie auch mit Affekten.
Wissen wird nur im materiellen Tun (als Teil der Leistung) sichtbar und bewertbar (Suchman 2000). Der Fokus aufs Tun wird auch durch die Unterscheidung zwischen »knowledge« (als passiver Bestand) und »knowing« (als aktiver Prozess im Vollzug des Tuns) in der neueren Literatur aus dem Bereich der Organisationsethnographie (z. B. Nicolini, Gherardi & Yanow 2003), aber auch in manchen Wissensmanagement-Modellen (z. B. Reinmann-Rothmeier 2001), aufbauend auf Polanyi (1966) und Schön (1984), unterstrichen.
Wissen sollte unmittelbar als Teil jedes Tuns gesehen werden, nicht als eigene Prozesse, die »woanders« ablaufen. Wie auch dieser Leitfaden klarmacht, sollte Wissensmanagement nicht als ein »was« der Organisation, sondern als ein »wie« begriffen werden. Diese grundsätzliche Logik wird auch in der folgenden Definition hervorgehoben: Wisssensmanagement ist »a dynamic and continuous set of processes and practices embedded in individuals, as well as in groups and physical structures where at any point in time in a given organization, individuals and groups may be involved in different aspects of knowledge management processes« (Alavi und Leidner 2001, 123).
Wissenstransfer mit Bezug auf sozio-materielle Praxis sehen[Bearbeiten]
Wissensmanagement sieht Wissenstransfer typischerweise als ein mechanisches Problem: Wissen lässt sich relativ unproblematisch von den Kontexten seiner Entstehung und Verwendung entkoppeln, speichern und anderen zur Verfügung stellen (und dabei bleibt das Wissen als Objekt prinzipiell ohne Veränderung). Dazu drei problematisierende Anmerkungen:
Erstens, wenn Wissen transferiert wird, wird es auch unvermeidlich transformiert und in andere Formen »übersetzt«. Ein Handbuch zum Basketball (kodifiziertes Wissen) ist nicht das gleiche wie die körperliche Fertigkeit des Basketballspielens. Das Handbuch ist zwar »mobiler«, stabiler und transparenter als die verkörperte Fertigkeit, es ist aber weit von der affektiven oder sensomotorischen Erfahrung des Spielens entfernt (und daher fürs Erlernen von Basketball weniger brauchbar als z. B. ein Einleitungsvideo). Dieses Beispiel soll zeigen, dass im Prozess eines »Wissenstransfers« Wissen oft mehreren Transformationen ausgesetzt wird. (In diesem Fall handelt es sich um zwei Übersetzungen: von einer Fertigkeit zu einem Handbuch (Person A); und von einem Handbuch zu der Fertigkeit (Person B).) Unterschiedliche Wissensformen (und dies gilt auch für unterschiedliche materielle Formen) besitzen unterschiedliche Merkmale, es wird ihnen unterschiedliche Bedeutung vonseiten der lokalen Kulturen zugeschrieben und sie werden unterschiedlich leicht in bestehende oder neue Praxen eingebunden.
Zweitens, die Verstrickung des Wissens mit Tun impliziert, dass ein erheblicher Anteil des Wissens implizit ist (wo auch körperliche Erfahrung eine starke Rolle spielt). Implizites Wissen von seinem Kontext zu lösen (um es zu formalisieren oder kodifizieren und daher »mobiler« machen), ist äußerst problematisch: Implizites Wissen wurde durch seine »Nichtverbalisierbarkeit« definiert (Polanyi 1966). (Zugleich hat Polanyi implizites Wissen – im Original »tacit knowledge« – und explizites Wissen nicht als zwei unterschiedliche Wissenstypen, sondern als zwei Dimensionen jeder bestimmten Wissensform gesehen.) Aus diesen Gründen wurde die berühmte Wissensspirale (Nonaka & Takeuchi 1995; Nonaka, Takeuchi und Umemoto 1996), die eine relativ unproblematische Transformation des impliziten in explizites Wissen durch Versprachlichung und Verschriftlichung voraussetzt, für ihre Widersprüchlichkeit kritisiert (s. z. B. Keane & Mason 2006). Es wäre empfehlenswert, die Möglichkeiten zu berücksichtigen, die implizites Wissen ohne eine Transformation zu explizitem Wissen (»tacit-to-tacit conversion«, Edge 2005; nur eine Übersetzung) zugreifbar machen, wie z. B. Beobachtung, Modellieren / Simulation, Imitation, »Job Shadowing« und informellen verbalen Austausch, wo Personen durch Analogien oder Metaphern ihr Können darstellen.
Drittens, die soziale Struktur des Wissens und Einbettung in lokale Kulturen wirken sich auf Wissenstransfer stark aus. Wie oben dargestellt, werden bestimmte Leistungen und Wissensformen von unterschiedlichen lokalen Kulturen (und die Organisationsleitung oder WissensmanagerInnen können eigene Kulturen darstellen) unterschiedlich interpretiert und bewertet – und dies wirkt sich auch auf das Teilen oder die Ausbreitung dieses Wissens aus (Miranda & Saunders 2003). Die stets wachsende Forschung zur Verbindung zwischen organisationaler Kultur und Wissensmanagement hat gezeigt, dass geteilte Werte stark zu Wissensaustausch beitragen (Levinthal & March 1993). Vertrauen, Offenheit und Kollaboration gehören zu spezifischen Werteausrichtungen, die zu einer größeren Bereitschaft für das Teilen von Wissen zwischen Organisationsmitgliedern beitragen – im Gegenteil zu Wertausrichtungen wie individuelle Macht und Wettbewerb (Von Krogh 1998, DeLong & Fahey 2000, Lee & Choi 2003). Wissen aus externen Quellen wird höher bewertet als Wissen aus internen Quellen, obwohl internes Wissen besser übertragbar ist. Sozialer Status und ingroup / outgroup-Status der WissensträgerInnen spielen ebenfalls eine starke Rolle (z. B. Sussman & Siegal 2003). Leistung wächst, wenn Mitglieder einer Gruppe wissen und schätzen, was die anderen wissen (»Wissenskarten« wären mögliche Tools).
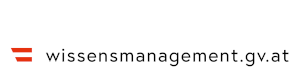

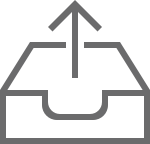 Hochladen
Hochladen