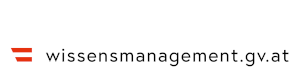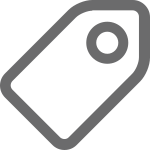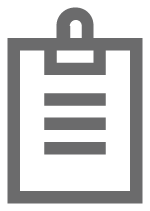Gewaltfreie Kommunikation
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden.
Gewaltfreie Kommunikation ist ein Handlung- bzw. Kommunikationskonzept, welches den Kommunikations- und Konfliktlösungsprozess beschreibt
Inhaltsverzeichnis
Hintergrund / Herkunft[Bearbeiten]
Die Geschichte der gewaltfreien Kommunikation beginnt in den frühen 1960er Jahren. Damals war Rosenberg mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in Auseinandersetzungen geraten. Der Prozess der Entwicklung der gewaltfreien Kommunikation setzte 1963 ein. Die gewaltfreie Kommunikation galt zu diesen Zeiten als Mittel, mit dem die Rassentrennung an Schulen und sonstigen Einrichtungen der Öffentlichkeit aufgelöst werden konnte.
Zielsetzung & Einsatzmöglichkeiten[Bearbeiten]
Gewaltfreien Kommunikation (GFK) wurde vom US-Amerikanischen Psychologen Marschall B. Rosenberg (1963) entwickelt. Es handelt sich dabei um ein Handlung- bzw. Kommunikationskonzept, welches den Kommunikations- und Konfliktlösungsprozess beschreibt. Richtig angewandt leistet es außerdem noch einen Beitrag zur friedlichen Kommunikationslösung. Dadurch können zwischenmenschliche Beziehungen entstehen, die auf Wertschätzung bauen, wodurch eine bessere Kommunikation und Kooperation sichergestellt werden soll. Auf diese neu aufgebaute wertschätzende Beziehung zielt die GFK auch ab, da durch langfristig eine bessere Kooperation und Kommunikation ermöglicht wird.
Mögliche Umsetzung[Bearbeiten]
Vorbereitung[Bearbeiten]
Wichtig bei der gewaltfreien Kommunikation ist das Verständnis, dass man sich von einer Kultur der gegenseitigen Vorwürfe, des Misstrauens und der gegenseitigen Kritik wegbewegen möchte, hin zu einer positiven bzw. verständnisvollen Konfliktkultur. Es versteht sich dabei von selbst, dass dies nur möglich ist, wenn alle Konfliktparteien die Möglichkeiten haben, ihren Gefühlen und Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen. Nur dadurch können die jeweils anderen Konfliktparteien diese auch verstehen, erkennen und nachvollziehen.
Durchführung[Bearbeiten]
Abschließend soll noch anhand des nachstehenden Beispiels die gewaltfreie Kommunikation nähergebracht werden. Dabei vergleichen wir zwischen gewaltfreier Kommunikation sowie vermischender Reaktion, bei der nicht nur beobachtet, sondern gleichzeitig auch bewertet wird.
| Überschrift | gewaltfreie Kommunikation | vermischte Reaktion |
|---|---|---|
| Beobachtung | Letzte Woche hast du den Staubsauer-Roboter weder montags noch donnerstags eingeschalten. Ich habe ihn dann selbst am Freitag eingeschaltet. | Die Reinigung unserer Wohnung ist dir gleichgültig |
| Gefühl | Das ärgert mich | Es provoziert mich, dass dir der Dreck in unserer Wohnung gleichgültig ist |
| Bedürfnisse | Ich möchte eine saubere Wohnung vorfinden, in der ich mich wohlfühlen kann | Du bist faul (Kein Bedürfnis, sondern eine moralische Verurteilung) |
| Bitte | Ich bitte dich, den Staubsaugerroboter zumindest einmal wöchentlich anzuschalten | Wenn du den Staubsaugerroboter nicht brauchst, verkaufe ich ihn im Internet |
Aufwand[Bearbeiten]
Die Implementierung der gewaltfreien Kommunikation erfordert Zeit, vor allem für Schulungen und Übung. Die Beteiligten sollen die Methoden verstehen und anwenden können. Es handelt sich um einen fortlaufenden Prozess und nicht nur um eine einmalige Schulung. Zudem werden oft auch externe Ressourcen wie Trainer oder Materialien benötigt.