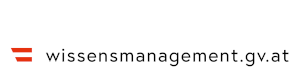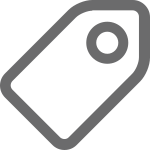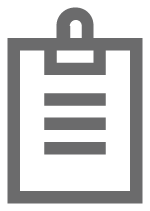Denkhüte von de Bono
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden.
Bei den Denkhüten nach de Bono handelt es sich um ein Wissensmanagementtool. Ziel dieser Methodik ist es, komplexe Aufgabenstellungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
Hintergrund / Herkunft
Die Methode der Denkhüte wurde 1986 von Edward de Bono konzipiert und erstmals vorgestellt. Edward de Bono war ein maltesischer Mediziner, Kognitionswissenschaftler und Schriftsteller.
Zielsetzung & Einsatzmöglichkeiten
Ziel dieser Methodik ist es, komplexe Aufgabenstellungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Dies geht der Annahme voraus, dass das Gehirn in der Lage ist, unterschiedliche Denkweisen direkt anzusteuern. Diese Denkweisen können zu unterschiedlichen Zeitpunkten einer Diskussion nützlich sein und daher ist es wichtig, diese zu trainieren.
Mögliche Umsetzung
Ein praktisches Beispiel für den Einsatz dieser Methode könnten Veränderungen bestehender Verfahrensabläufe sein. Hier gibt es oftmals verschiedenste Ansichten und erfahrungsgemäß sind jene Kollegen*innen welche bereits länger innerhalb der Struktur tätig sind, eher weniger bereit, hier große Veränderungen vorzunehmen. („never change a winning team“) Wenn es also zu potenziellen Verbesserungsvorschlägen kommt, könnten diese gesammelt und in einem Jour-Fixe unter den unterschiedlichen Aspekten beleuchtet werden. Die unterschiedlichen Blickwinkel können sicherlich hilfreich sein, um sich auf Neuerungen einzulassen und diese zumindest einmal durchzudenken. Zusätzlich wären hier alle Beteiligten auf einer Stufe angesiedelt und könnten gemeinsam eine Lösung erarbeiten, ohne auf das letzte Wort der Führungskraft angewiesen zu sein. Ein so erarbeiteter Lösungsvorschlag könnte dadurch zu mehr Akzeptanz und damit zur Bereitschaft einer optimalen Umsetzung führen.
Vorbereitung
Farben
- weiß - objektiv, neutral
- rot - subjektiv, emotional
- schwarz - pessimistisch
- gelb - optimistisch
- grün - kreativ, wertfrei
Durchführung
Zunächst stellt der*die Moderator*in die Problemstellung und die Denkhüte, welche nach Farben sortiert sind, vor. Dies ist wichtig, da sich die Teilnehmer*innen in weiterer Folge in die Rollen hineinversetzen sollen. Anschließend wird die Anfangsfarbe gewählt und alle Teilnehmer*innen diskutieren das Thema unter diesem Aspekt. Diese Erkenntnisse werden dokumentiert und gesammelt. Dann kommt es solange zum Wechsel der Farben, bis diese einmal "durchgespielt" sind. Der ganze Vorgang kann solange wiederholt werden, bis keine neuen Ideen mehr entstehen. Zum Abschluss werden alle gesammelten Ideen beleuchtet und diskutiert.
Anwendungsgebiete und Voraussetzungen
- Komplexe Problemstellungen können ebenso Anwendungsgebiet sein wie brodelnde
Konfliktherde innerhalb von Gruppen
- Notwendig sind hierfür mindestens 7 Personen, wobei 6 davon die unterschiedlichen Blickwinkel (Hüte) repräsentieren und der*die Siebte als Moderator*in fungiert.
Aufwand
Einsicht
Die Methodik halte ich grundsätzlich für eine gute Idee, wenn es darum geht, festgefahrene Standpunkte aufzulösen. Die unterschiedlichen Denkhüte können dabei helfen, andere Perspektiven zu eröffnen. Ich denke jedoch, dass diese Methode eine gewisse Offenheit voraussetzt und somit nur bedingt für die Findung essenzieller Entscheidungen und Lösungen einsetzbar ist. Außerdem setzt sie einerseits eine gewisse Gruppengröße und andererseits einen größeren zeitlichen Rahmen voraus.
Folgerungen
- Vor dem Einsatz des Tools sollte eruiert werden, ob dieses überhaupt für die vorgegeben Rahmenbedingungen anwendbar ist.
- Die Teilnehmer*innen sollten im Vorhinein instruiert werden und die grundsätzliche Bereitschaft muss erkennbar sein.
- Wichtig ist es, etwaige äußere Einflüsse möglichst zu verhindern.
- Der*die Moderator*in sollte versuchen, die Teilnehmer*innen dabei zu unterstützen, die Rollen genau zu verstehen und anzuwenden. Hier könnten Beispiele hilfreich sein.